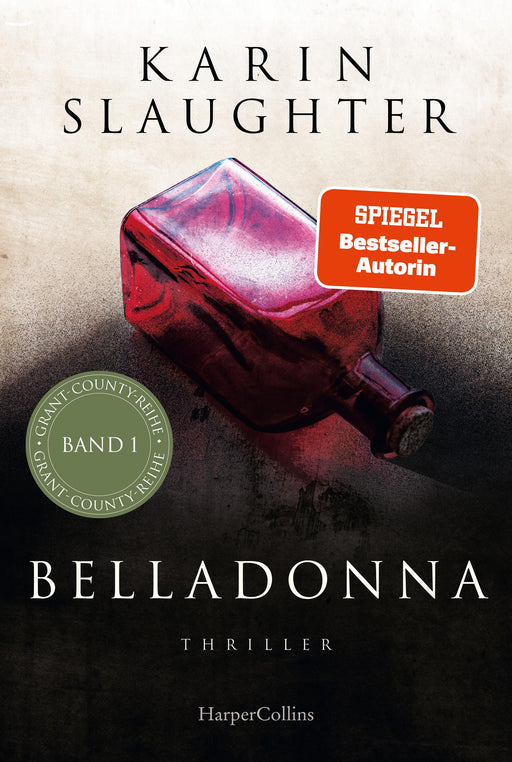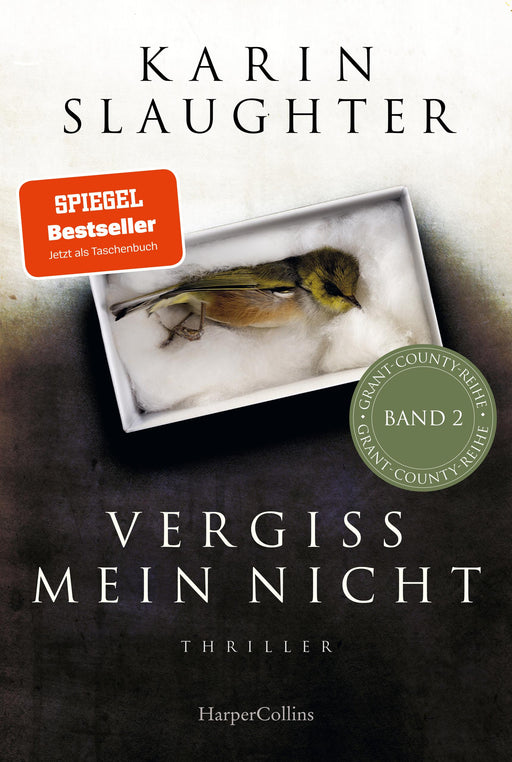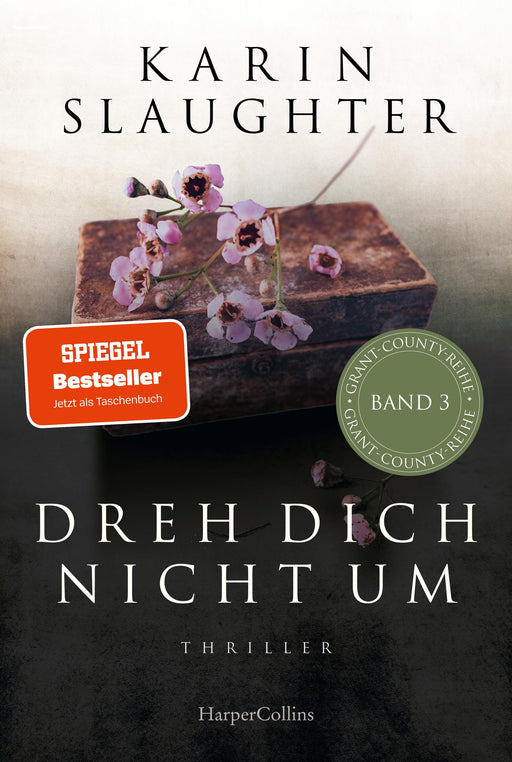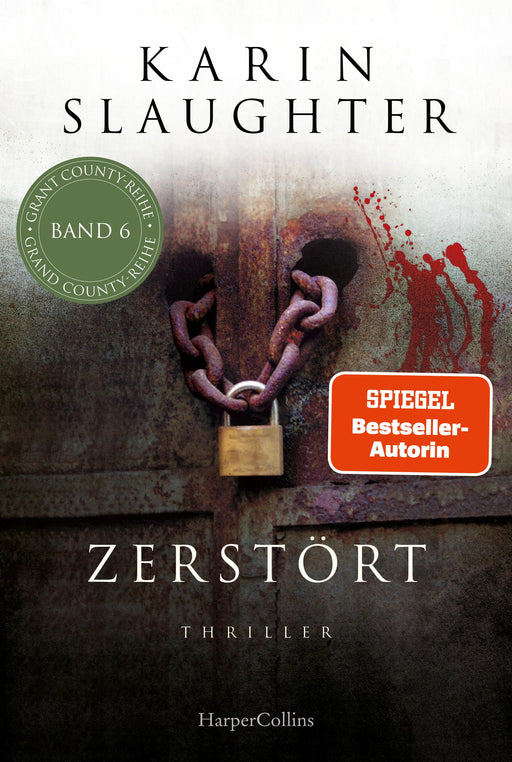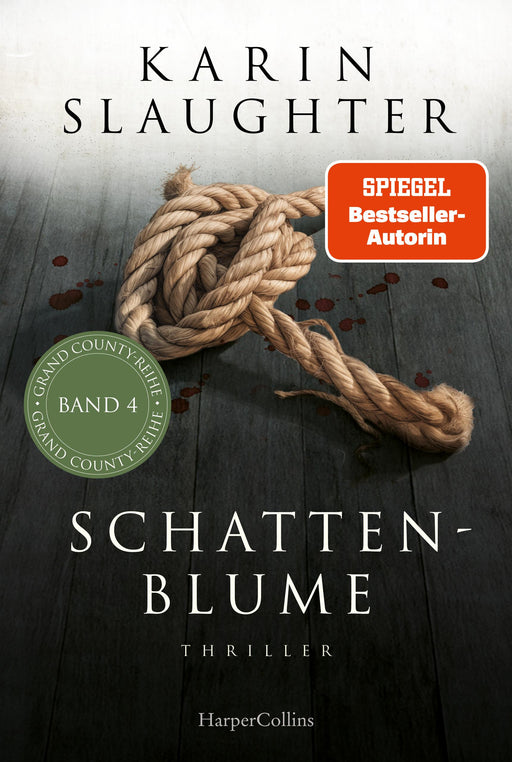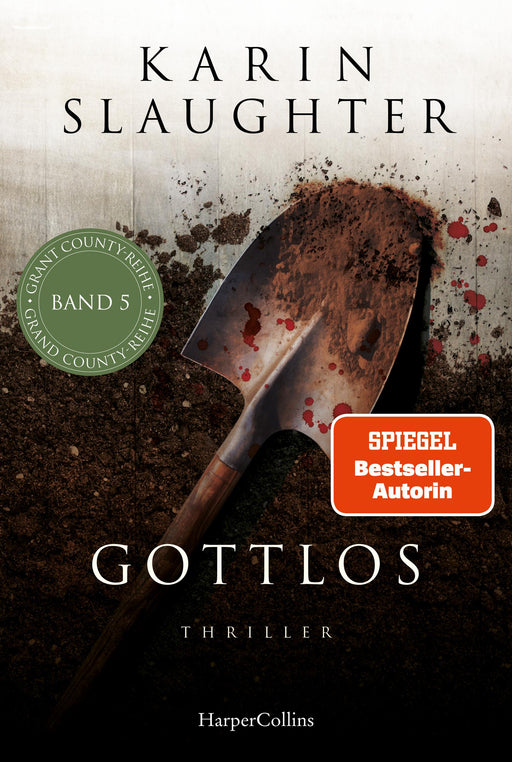Belladonna
A star is born: Karin Slaughters brillianter Debütroman
Eine Collegeprofessorin wird aufgeschlitzt in einer Restauranttoilette gefunden. Für die junge Frau gibt es keine Rettung mehr, und die einst so friedliche Kleinstadt Heartsdale ist schwer erschüttert. Die Gerichtsmedizinerin Sara Linton findet heraus: Das wahre Grauen des Opfers begann schon lange vor seinem Tod. Nach und nach enthüllt sich ihr der morbide Plan eines sadistischen Psychopathen – und eine furchtbare Erkenntnis: Ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit könnte den Killer überführen … oder ihren eigenen Tod bedeuten.
Sara Lintons erster Fall – der spannende Auftakt zur Grant-County-Serie
Die Grant-County-Reihe umfasst sechs Bände. Heldin ist die toughe Sara Linton. Sie arbeitet im Städtchen Heartsdale im Grant County als Kinderärztin und Rechtsmedizinerin. Ihr Ehemann Jeffrey Tolliver ist der örtliche Polizeichef.
1 – Belladonna
2 – Vergiss mein nicht
3 – Dreh dich nicht um
4 – Schattenblume
5 – Gottlos
6 – Zerstört
»Karin Slaughter zählt zu den talentiertesten und stärksten Spannungsautoren der Welt.« Yrsa Sigurðardóttir
»Jeder neue Thriller von Karin Slaughter ist ein Anlass zum Feiern!« Kathy Reichs