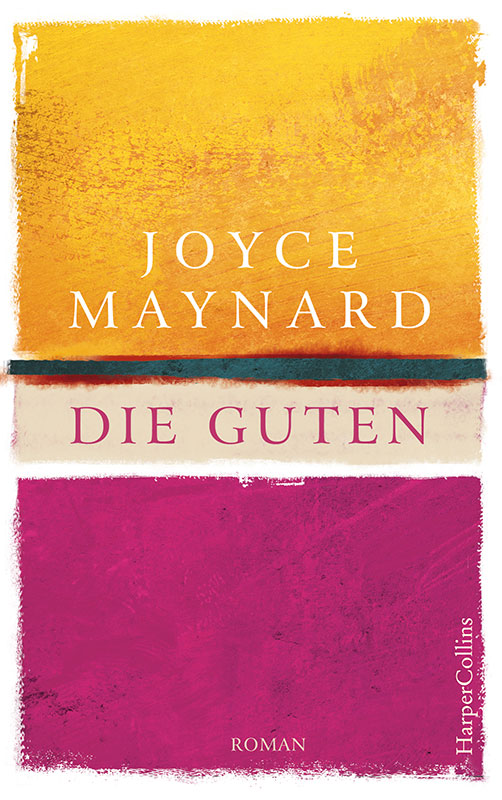Die Guten
Sichern Sie sich nach "Gute Töchter" jetzt den neuen Roman "Die Guten" von Joyce Maynard:
Nach dem Ende ihrer Ehe fühlt Helen sich einsam, selbst zu ihrem kleinen Sohn findet sie keinen Zugang mehr. Dann lernt sie Ava und Swift Havilland kennen. Das charismatische Paar heißt Helen mit offenen Armen in ihrer Welt willkommen - einer Welt von interessanten Menschen, ausgelassenen Partys und Wohlstand. Immer stärker gerät die junge Frau in den Bann ihrer neuen Freunde. Bis sie feststellen muss, dass diese Freundschaft an Bedingungen geknüpft ist. Und dass sie dadurch im Begriff ist, zu verlieren, was sie am meisten liebt.
"Genauso wie Helen von den Havillands in den Bann gezogen wird, wird auch der Leser von dieser völlig betörenden, unbedingt lesenswerten Geschichte eingesogen." Booklist