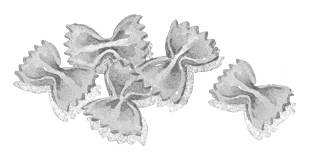Dorf ist Mord
Stella hat sich nach Jahren in Deutschland einen Traum erfüllt: ein Ferienhaus in ihrer Heimat Italien. Ein kleines Dorf im Norden des Landes soll ab sofort ihr zweites Zuhause sein. Zu sehr hat sie den italienischen Lebensstil und die Sonne vermisst. Die Uhren schlagen in Pelati langsamer, und alles, was man wissen muss, erfährt man im Café von Franco. Stella freundet sich mit Marta an, einer Frau aus dem Nachbardorf. Doch plötzlich kehrt diese nicht von ihrer täglichen Bootsfahrt auf dem See zurück. Während einige fest überzeugt sind, dass sie der Seehexe zum Opfer fiel, glaubt Stella an ein Verbrechen. Sie überredet den Dorf-Carabiniere, der einer schönen Frau keinen Wunsch abschlagen kann, mit ihr in diesem geheimnisvollen Fall zu ermitteln