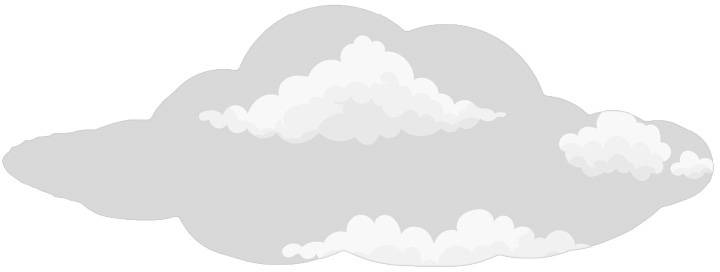Cato und die Dinge, die niemand sieht
„Ein Buch, das von Anfang bis Ende bewegt und fasziniert.“ (Jurybegründung Goldener Griffel, Niederlande 2022)
Es gibt Momente im Leben, die möchte man unbedingt noch einmal erleben. Und es gibt Moment im Leben, die möchte man ungeschehen machen. Beides ist unmöglich, denkt Cato, bis sie eines Tages eine Visitenkarte auf dem Klavier ihres Vaters findet: „Filme, die nirgends laufen, die du aber schon immer sehen wolltest“, steht darauf. Die Adresse führt Cato zu der mysteriösen Frau Kano, die in ihrem Kino besondere Zeitreisen anbietet. Hat Cato hier vielleicht die Möglichkeit, zum ersten Mal ihre Mutter zu treffen? Auf der Suche nach der Wahrheit wird sie auf einer gefährlichen Reise durch Zeit und Erinnerungen mitgerissen, bis sie vor einer Entscheidung steht, die ihr Leben für immer verändern wird.
Ein berührender Kinderroman über Familie, Identität und die Besonderheit der kleinen Momente im Leben