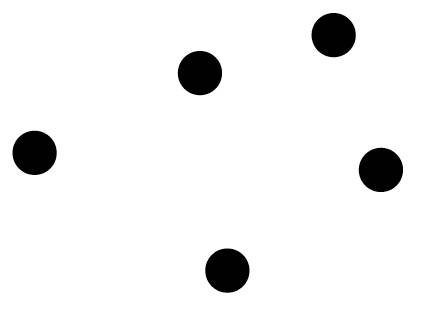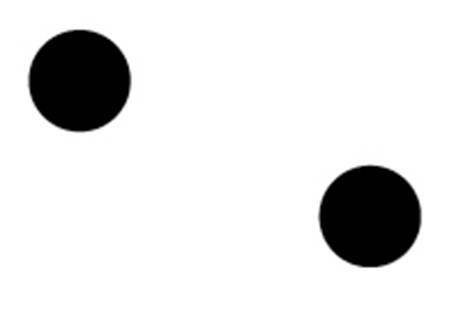Das Tal der Puppen
Schon lange vor Carrie Bradshaw hielt Jacqueline Susann die Welt mit ihren skandalösen Geschichten von drei jungen Frauen in New York in Atem. Als "Das Tal der Puppen" vor über 50 Jahren veröffentlicht wurde, stürmte es augenblicklich alle Bestsellerlisten. Nie zuvor hatte ein Buch so offen über Sex, Drogen und das Show-Business berichtet. Mit mehr als 35 Millionen Exemplaren gilt es als eines der meistverkauften Bücher aller Zeiten.
Anne, Neely und Jennifer haben einen Traum: es als Bühnen- und Filmstars ganz nach oben zu schaffen. Um das zu erreichen, scheint ihnen kein Hindernis zu groß. Doch als der Druck, schön und erfolgreich zu sein, übermächtig wird, greifen sie zu gefährlichen Hilfsmitteln: Appetitzügler, Beruhigungspillen, Schlaftabletten. Nach außen führen sie das perfekte Leben - doch hinter den glitzernden Kulissen wird der Traum zum Albtraum.
»>Das Tal der Puppen< ist auch heute noch ein kultureller Meilenstein.«
The New York Times Style Magazine
»Ich bewundere die rohe Energie, die Detailtreue und die brutale Authentizität der Darstellung von New Yorks Showbiz. Ich habe von Jacqueline Susann gelernt.«
New-York-Times-Bestsellerautorin Anne Rice
»Ein starkes, mutiges, wütendes und ja, definitiv auch ein feministisches Buch.«
The Guardian
»Ein zeitloser Klassiker. Heute wäre Neely eine YouTube-Sensation, Jennifer eine Instagram-Influencerin und Anne eine Snapchat-Königin.«
Paper Magazine
»Welterfolg in frischer Neuübersetzung.« Wilhelmshavener Zeitung