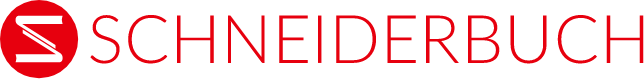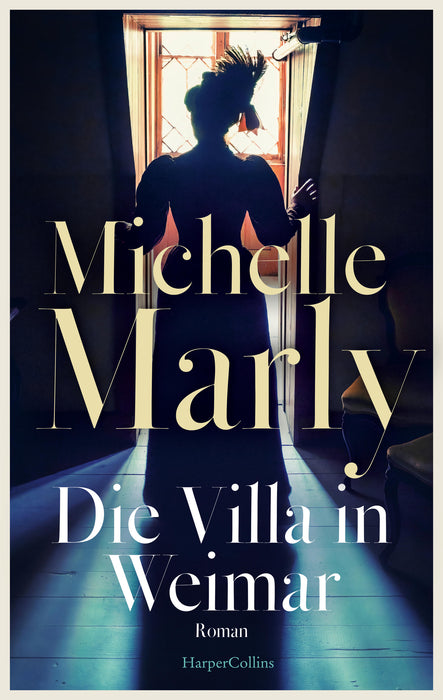
Die Villa in Weimar
Sommer 1897: Die weltberühmte Schauspielerin Marie Seebach hat einen Teil ihres großen Vermögens in einer kürzlich gegründeten Stiftung angelegt und damit ein einzigartiges Altersheim für mittellose Bühnenkünstler in Weimar geschaffen. Da erfährt sie von Unregelmäßigkeiten. Misstrauisch verfolgt sie die Vorgänge aus ihrem Urlaubsdomizil Sankt Moritz und bittet Lotte Wernitz, eine junge Krankenschwester, nach Weimar zu fahren und sich inkognito umzusehen.
Doch bevor Lotte erste Briefe an die alte Dame schreiben kann, werden alle Beteiligten in Weimar durch eine traurige Nachricht aufgeschreckt: Marie Seebach ist an einer Lungenentzündung gestorben. Offenbar ist ihre Schwester Wilhelmine die Universalerbin und damit die Frau, an der nunmehr der Fortbestand der Stiftung hängt. Die alten Herrschaften sind in Aufregung, überlegen, was zu tun ist, um ihren Alterssitz auf jeden Fall zu retten – denn Wilhelmine scheint ihnen nicht wohlgesonnen …