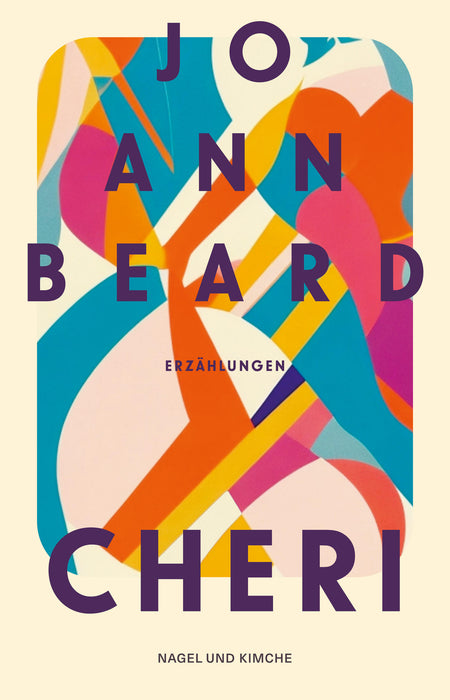
Cheri
Cheri, eine an Krebs erkrankte Frau, begibt sich auf ihre letzte Reise und gewinnt kraft ihrer Erinnerungen eine neue Wertschätzung für die Schönheit des Lebens und die Bedeutung des Augenblicks. Werner, ein New Yorker Maler, sieht sich in seiner brennenden Wohnung gefangen und wagt mit einem Sprung aus dem fünften Stock einen heroischen Fluchtversuch. Und eine Schriftstellerin führt das herausfordernde Unterfangen, ihre acht Enten einzufangen zu erhellenden Einsichten über das eigene Schreiben.
In drei meisterhaften Erzählungen verwebt Jo Ann Beard kunstvoll Fiktion mit persönlichen Anekdoten, erzählt von Schmerz, Hoffnung und Zerbrechlichkeit.


