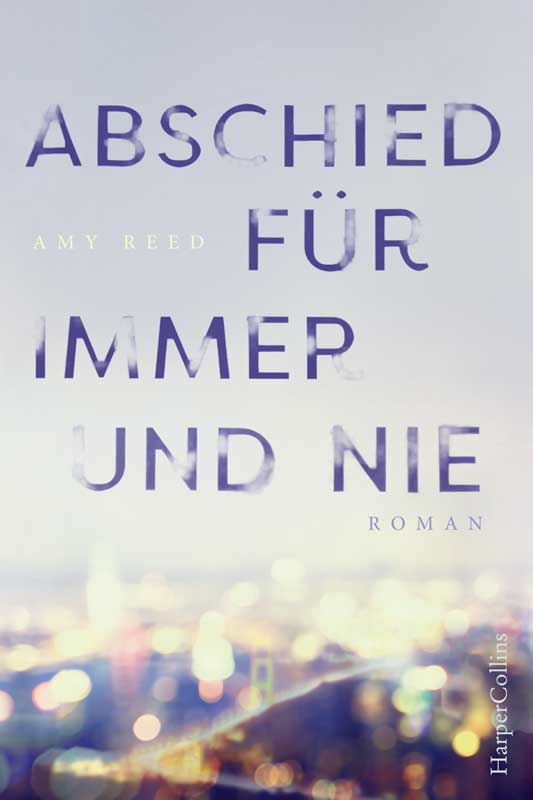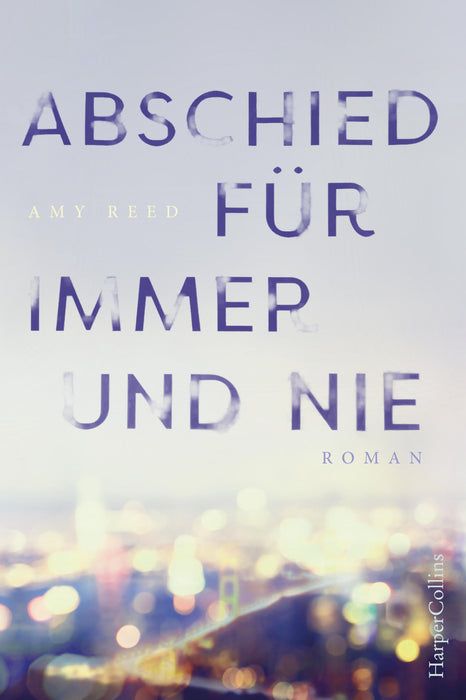
Abschied für immer und nie
"Es gibt es so viele Bücher über Trauer und Verlust, über den Abschied von geliebten Menschen. Aber es gibt kein Buch darüber, wie man ihn zurücknimmt, diesen Abschied."
Was die krebskranke Evie noch will, ist eine letzte Reise. Noch einmal das Adrenalin in den Adern spüren. Noch einmal auf den Rat ihrer Freundin Stella hören: Lebe wagemutig. Aber die Flucht aus der Klinik wird alles verändern …
Evie fällt es unsagbar schwer, in die Welt der Gesunden zurückzufinden. Bis sie Marcus trifft. In seiner Nähe fühlt sie sich lebendig. In seinen Exzessen, seinen fantastischen Höhenflügen. Nur ahnt sie nicht, dass sie nur einen Schritt vor dem Abgrund steht …
"Mal im Ernst, Evie, was haben wir schon zu verlieren?"