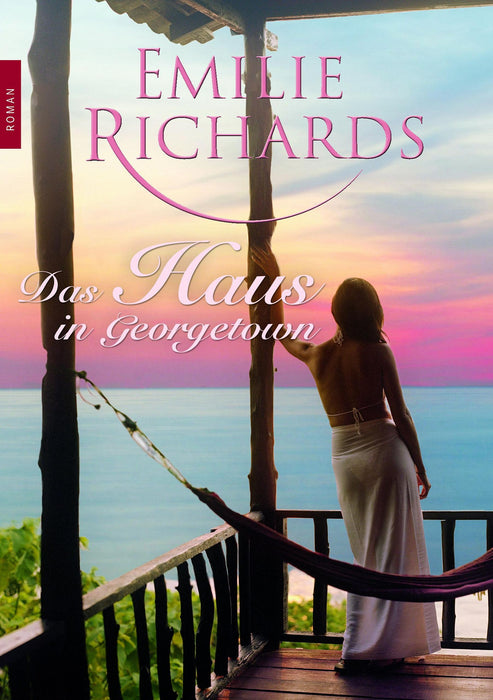
Das Haus in Georgetown
Etwas Entsetzliches geschah vor vielen Jahren in dem Haus in der Prospect Street, das Faith nach der Scheidung mit ihren Kindern bezieht …
Es sind nur wenige Sekunden. Aber sie reichen, um Faiths' bisheriges Leben zu zerstören: Sie überrascht ihren Mann in den Armen seines Liebhabers! Sie verlässt ihn, entschlossen, einen neuen Anfang zu wagen, und zieht mit ihren Kindern in das alte Haus in der Prospect Street, das seit Generationen im Besitz ihrer Familie ist. Hier ist nichts zu spüren von dem gediegenen Luxus, an den Faith bis jetzt gewöhnt war. Zum Glück geben ihr die aufregend neuen Gefühle, die sie für ihren Nachbarn Pavel entdeckt, die Kraft und Zuversicht, die sie jetzt so dringend braucht. Denn das Haus ist eine Herausforderung - die wächst, als Faith bei Nachforschungen über seine Geschichte auf ein düsteres Kapitel ihrer eigenen Familie stößt …

