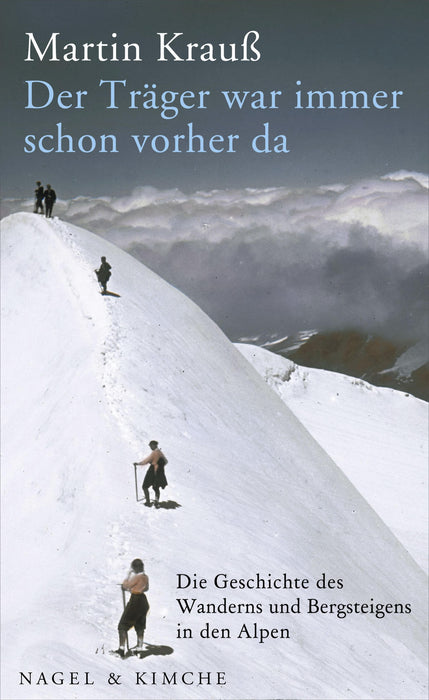
Inhalt
Warum Bergsteigen immer unten beginnt und was das zu bedeuten hat
1770 bis 1820: Aufgeklärte Städter entdecken die Alpen und treffen dort auf selbstbewusste Einheimische
1820 bis 1855: Wie sich die Älpler gegen die Hochtouristen wehren und einfach ihre Berge nicht hergeben
1855 bis 1880: Die Gentlemen erklären sich zu Erstbesteigern und lassen sich von Wilderern den Weg auf den Gipfel zeigen
«Geheimwissen endlich verfügbar»
1880 bis 1895: Wenn die Bürger die Älpler nicht mehr brauchen und glauben, plötzlich allein losstiefeln zu können
«Nur Akademiker germanischen Stammes»
1895 bis 1914: Bergsteigen soll exklusiv bleiben, ohne Pöbel und ohne Juden. Aber Arbeiter drängen in die Alpen, und Wilderer werden zu Volkshelden
«Teifel, Teifel, da schiaßen’s ja auf d’Leit»
1914 bis 1918: Wenn die Militärs die Alpen sprengen wollen und wo mitten im Weltkrieg ein bisschen Frieden herrscht
«Familie Ekel und die Klettertrottel»
1918 bis 1924: Die Revolution erfasst die Bergsteiger, die Alpen werden demokratisch, doch der Judenhass nimmt zu
«Die wilden und schwarzen Führer»
1924 bis 1933: Bergvagabunden wollen in den Hochalpen leben, Frauen klettern sich frei, und Kommunisten besteigen den Kaukasus
«Mit Judenstämmling auf dem Gipfel»
1933 bis 1938: Wie die Nazis nur arische und akademisch gebildete Deutsche in den Himalaya vorlassen und eine Katastrophe nach der anderen produzieren
«Adolf-Hitler-Spitze (5642 m)»
1938 bis 1945: Bergsteiger kämpfen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Aber der Alpenverein bildet den Nachwuchs für die Wehrmacht aus
«Und ihr nennt euch Bergführer!»
1945 bis 1968: Naturfreunde sehen sich als Sieger, doch die alten Nazis klettern wieder die Berge hoch
1968 bis 1995: Das Ende der Wehrmachtsalpinisten, die Entdeckung der Umwelt, und wie aus dem Sportklettern das Bungeespringen entsteht
«Der wohl ‹einfachste› Achttausender»
1995 bis heute: Wie Klettern auf Brücken zum Gegenstück des Himalayatourismus wird. Und warum immer noch Menschen über die Alpen flüchten
Aufbruch
Warum Bergsteigen immer unten beginnt und was das zu bedeuten hat
«Sie sind der mit diesem merkwürdigen Thema?», fragte mich Reinhold Messner, als ich ihn zum Interview traf. «Wo es darum geht, was Träger, Wilderer und Schmuggler mit der Alpingeschichte zu tun haben?»
Genau. Der berühmteste Bergsteiger der Gegenwart hat das Thema dieses Buches gut zusammengefasst. Die Geschichte des Alpinismus wird nämlich gern von oben erzählt: von den Erstbesteigern, den hohen Gipfeln, den großen Helden. Aber der Anstieg beginnt immer unten. Es sind nicht nur die Leute unterwegs, die oben ankommen. Nicht nur die Erstbesteiger, sondern auch die, die vor ihnen da waren: die Bauern, Kristallsucher und Gemsjäger. Es gab die Wilderer, die dem Kurfürst das Recht, über Vieh und Wald zu verfügen, streitig machten. Die Hirten und Sennen, ohne die kein Gentleman und kein Naturforscher je auf einen Gipfel gekommen wäre. Die Schmuggler und andere Illegale, die sich in die Berge zurückzogen, legten Wege an, auf denen wir bis heute gehen. In den Zwanzigerjahren drangen die Arbeiter in die Alpen vor – und die Juden wurden aus den bürgerlichen Alpenvereinen hinausgeworfen. Während des Nationalsozialismus halfen Bergsteiger bedrohten Menschen bei ihrer Flucht. Auch heute noch gibt es die anderen Bergsteiger, die Rebellen, die Gescheiterten und manchmal Eingeknickten – sie stellt dieses Buch in den Mittelpunkt: die Magd und den Kristallsucher, die als Erste auf dem Montblanc waren. Den Wilderer, der dem berühmten Erstbesteiger zeigte, wie er auf die Gipfel kommt. Die Kommunistin, die um ein Haar als erster Mensch die Eigernordwand durchstiegen und den Nazis ihren Propagandaerfolg vermasselt hätte.
Dieses Buch will auch zeigen, gegen wen diese Rebellen ankämpfen, anklettern mussten: Großfürsten, Vereinsfunktionäre, große und kleine Nazis und andere, die glaubten, einfach definieren zu dürfen, wen sie als Bergsteiger anerkannten und wen nicht.
Vielen ist zu danken, die mir auf kleine, große oder sehr große Weise geholfen haben, dieses Buch zu schreiben. Besonders bedanken möchte ich mich bei: Gerhard Armanski, Ivo Bozic, Matthias Breit, Lothar Eberhardt, Wieland Elfferding, Rainer Engelmann, Christof Girgenrath, Egon Günther, Torsten Haselbauer, Thomas Hölzl, Knud Kohr, Andreas Krauß, Monika Krauß, Bernd Ladwig, Cécile Lecomte, Mechthild Linnebur, Reinhold Messner, Malte Oberschelp, Lorenz Peiffer, Stefan Ritter und dem Team des DAV-Archivs in München, Joachim Schindler, Werner Siefert, Valentin Sima, Eberhard Spohd, Veronika Springmann, Stephan Stracke, Dirk Vaihinger, Philipp Vergin, Renate Wapler und dem Team der Bibliothek des DAV Berlin, Jochen Zimmer und ganz besonders bei Cornelia Ogiolda.
«Berge heißen nicht»
1770 bis 1820: Aufgeklärte Städter entdecken die Alpen und treffen dort auf selbstbewusste Einheimische
Jacques Balmat war Kristallsucher, und Michael-Gabriel Paccard war Arzt. Zusammen standen sie am 8. August 1786 um 18.23 Uhr auf dem Montblanc. Die Erstbesteigung des mit 4810 Metern höchsten Bergs der Alpen gilt als Beginn des Alpinismus. Drei Jahre später stürmte das Volk die Bastille in Paris und besiegelte den Sieg der Französischen Revolution.
Dass sich nach der Gipfelerstürmung von Balmat und Paccard sogleich Diskussionen entzündeten, wer denn der «richtige» Erstbesteiger sei, ob Paccard als bloß der Wissenschaft ergebener Arzt hochgegangen sei, ob Balmat «nur» Führer gewesen sei und, weil er materielle Interessen verfolgte, gar nicht als Bergsteiger gelten dürfe – das sind Diskussionen, die ohne die Französische Revolution gar nicht möglich wären.
Ja, dass überhaupt die Menschen plötzlich erpicht darauf waren, den Teil der Welt zu erobern und auszuforschen, der lange als Sitz der Götter gegolten hatte, von dem, etwa in Form von Lawinen, kaum erklärliche Gefahren drohten.
Im Jahr 1760, als Teil des großen Projekts der Aufklärung, hatte der Genfer Naturforscher Horace Bénédict de Saussure eine Prämie ausgelobt für denjenigen, der ihm den Weg auf den Montblanc zeigt. Die Prämie – man spricht von gerade mal fünfzig Francs – ging an Jacques Balmat. Ein Jahr nach dessen Erstbesteigung, 1787, ließ sich de Saussure von achtzehn Führern und einem Diener auf den Montblanc geleiten. Zu seiner Ausrüstung gehörten Thermometer, Luftdruckmesser, Höhenmesser und naturwissenschaftliche Utensilien, mit denen de Saussure den Berg, den Schnee, die Steine, die Luft und einfach alles, was er oben fand, erforschen und vermessen wollte.
Das Projekt, den Mythos der Berge zu entzaubern, begeisterte die Aufklärer. Voltaire schrieb in seinem Philosophischen Wörterbuch unter dem Stichwort «Geografie»: «Vor meinen Augen erstrecken sich über vierzig Meilen hinweg schneebedeckte Bergketten, auf die noch nie ein Mensch, ja nicht einmal ein Vogel, seinen Fuß gesetzt hat.»
Die Besteigung des Montblanc dürfte für die Durchsetzung des Bürgertums in Europa von größerer Bedeutung sein als die Erstürmung der Bastille.
Bis 1744, als der Genfer Ingenieur Pierre Martel eine Karte des Gebiets um Chamonix vorlegte, hieß der Montblanc bei den Menschen in Chamonix nur «Mont Maudit», der verwünschte, der verfluchte Berg. Martel wollte schon 1742, deutlich vor de Saussure, den Montblanc besteigen, zusammen mit fünf anderen hochgestellten Herren, darunter ein Mineralienkenner und ein Botaniker, sowie sieben Trägern, die die Expedition führten. Doch Martel kam zu dem Ergebnis, der Montblanc sei «unbesteigbar».
Mit Blick auf Saussures Prämie hatte sich 1760 ein Mann namens Peter Simond am Montblanc versucht. 1775 waren es vier Männer aus Chamonix – alle scheiterten. Es folgten viele Besteigungsversuche, mehrere kamen bis über 4000 Meter Höhe. Im Jahr 1784 wurde bei einem dieser Versuche der Dôme du Goûter (4304 m) von den Einheimischen Jean-Marie Couttet und François Cuidet bestiegen, der erste dokumentierte Viertausender der Weltgeschichte.
Im August 1786, nach gründlicher Vorbereitung, erreichten dann Balmat und Paccard zusammen den Gipfel des Montblanc. Von Chamonix aus wurden die beiden mit Ferngläsern beobachtet. «Für das Selbstverständnis des Alpinismus ist es nicht ohne Belang, wer von beiden der Wichtigere war», schreibt Helga Peskoller, eine österreichische Extrembergsteigerin und Alpinhistorikerin. «Die Grenze zwischen Herr und Führer soll scharf gezogen, die Hierarchie von unten und oben einsichtig werden.» Mit dem Hintergrund der Französischen Revolution ist es also auch eine Standes- oder Klassenfrage, wer mit dieser Großtat den Alpinismus begründete: der Arzt und Sohn eines Notars Paccard – oder der Bauer und Kristallsucher Balmat.
Francis Keenlyside nennt in seinem Standardwerk zur Alpinismusgeschichte, Berge und Pioniere, Balmat einen bloßen «Träger». Und der deutsche Bergsteiger und -filmer Hans Ertl schwärmt von Paccard als «dem dritten, dem wahren Helden» neben Saussure und Balmat.
Erst 1984 fand sich in einem Archiv Paccards Bericht, den er 1823 als Brief verfasste. Darin berichtet er, wie Balmat einen Steilhang umgehen wollte, «den ich mutig überwand, um direkt auf den höchsten Gipfel des Montblanc zu gelangen – dass der Umweg ihn etwas zurückwarf und dass er gezwungen war zu laufen, um fast gleichzeitig mit mir auf dem Gipfel anzukommen». Ob dieser Bericht, 37 Jahre nach der Erstbesteigung geschrieben, den Tatsachen entspricht, lässt sich nicht mehr klären.
Bis heute weiß man kaum etwas über die Rolle der Träger und Helfer, die den hochbürgerlichen oder feudalen Herrschaften den Weg wiesen, die ihnen die wissenschaftlichen Geräte, den Rotwein und den Hasenbraten auf die Berge trugen und die oft die Wege schon kannten. Der Kulturhistoriker Martin Scharfe schreibt, dass es ein «bekanntes und häufig erfahrenes Paradoxon des sogenannten Erstersteigers ist, der auf dem soeben erreichten Gipfel anonyme Spuren früherer Ersteiger, etwa ein Artefakt oder ein Steinmännchen findet».
Dabei waren die Alpenbewohner an Gipfelbesteigungen nicht interessiert. Höchstens Jäger, Kristallsucher und Hirten kamen mal ganz nach oben, weil sie Tiere verfolgten oder wertvolle Steine suchten. Aber das waren keine Begehungen, die dem Genuss des Panoramas dienten. Man sprach einfach nicht darüber. Noch weniger die Schmuggler und Wilderer oder auch die Flüchtlinge. Für sie war es im Allgemeinen besser, nicht darüber zu reden.
Das Wort «Berg» stand noch im 18. Jahrhundert sowohl für Gipfel als auch für Alpen, in der Schweiz wurden auch Pässe so bezeichnet. In Grimms Wörterbuch lernt man, dass es die «Aussicht» in der deutschen Sprache erst seit dem 18. Jahrhundert gibt, und Gipfel hatten keine Namen. «Berge heißen nicht», sagt der Geißenpeter in Johanna Spyris Heidi. Nur Pässe und Joche waren würdig, einen Namen zu tragen.
«Heute denkt man in Bergen, damals dachte man in Pässen», notierte 1931 der Autor Alfred Steinitzer. Und Martin Scharfe schreibt: «Die einen, die Bürger, wollten hinauf, schafften das aber nicht aus eigener Kraft; die anderen dagegen, die hätten hinaufkommen können, ‹wollten› letztlich nicht auf die Gipfel.»
Was die sogenannten Bergler hatten war etwas, das man heute alpinistische Kompetenz nennen würde. Sie waren trittsicher, kannten das Wetter, legten Wege und Steige an, und auch Sicherungstechniken waren bekannt: Schon 768 schilderte der Bischof von Freising eine Geschichte aus seiner Kindheit in der Gegend um Meran, als er eine Felswand siebzig Meter hinabgestürzt war: Die Dorfbewohner ließen sich mit Seilen hinab und bargen den Jungen lebend. «Das Klettern ist also nicht, wie man häufig hört, eine Erfindung der Neuzeit», schreibt Helga Paskoller, «sondern es gehörte seit Jahrhunderten schon zum Alltag derjenigen, die sich in den Bergen niedergelassen hatten.»
Nur der Wille, die Gipfel zu erobern, fehlte weitgehend. Die Bauern gingen nur so hoch, wie das Vieh ging. Nur Einzelne wollten höher: Ein Pfarrer namens Zodrell aus Lavin im Unterengadin soll schon Anfang des 18. Jahrhunderts mit Steigeisen auf den von Gletschern umgebenen Piz Linard (3411 m) in der Silvretta gestiegen sein. Als offizieller Erstbesteiger gilt freilich der Schweizer Naturforscher Oswald Heer, der den Berg 1835 bestieg, geführt von dem Einheimischen Johann Madutz. Zu den Gerüchten um den Pfarrer Zodrell gehört auch, dass er auf dem Gipfel Steigeisen fand und sie mit den seinigen austauschte. Über den Piz Linard kursiert noch ein anderes Gerücht: 1572 soll ein Mann namens Chounard allein ein goldenes Kreuz auf den Gipfel getragen haben.
Sogar die Jungfrau (4158 m) in den Berner Alpen soll schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts von zwei Gemsjägern bestiegen worden sein – ein Messer sollen sie zurückgelassen haben.
Ähnliches wird von Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze (2962 m), berichtet. Der Historiker Thomas Linder vermutet, dass weit vor der offiziellen Erstbesteigung – im August 1820 durch den Leutnant und Vermessungstechniker Josef Naus, seinem Gehilfen namens Maier und dem Bergführer Johann Tauschl – Hirten und Jäger nahe am Gipfel waren. Es gibt auch die Vermutung, dass Schmuggler sich Wege über den Gipfel der Zugspitze suchten; ferner wurde eine Karte gefunden, die um 1770 entstand und einen Weg «ybers blath ufn Zugspitz» beschreibt.
Diese Menschen also, und ein paar Abenteurer wie Pfarrer Zodrell und vielleicht auch Chounard, dessen Existenz nicht verbürgt ist, waren die Vorläufer der Alpinisten.
An solche Leute dachte Horace Bénédict de Saussure, als er 1760 seine Prämie für den Mann auslobte, der ihn zuerst auf den Montblanc brächte. Die zunächst aus Städten wie Genf, später aus London, Wien oder Berlin anreisenden Herren Hochtouristen wären bei ihrer Erschließung der Alpen ohne die Kompetenz der Bergbewohner gescheitert.
Ähnliches gilt auch für den Versuch von Alexander von Humboldt, im Jahr 1801 den Chimborazo (6297 m) in den Anden zu besteigen. Humboldt, der immerhin bis zur Höhe von 5350 Meter kam – Höhenweltrekord an dem Berg, den man damals für den höchsten der Welt hielt –, war mit zwei weiteren Naturforschern und einem Diener unterwegs.
Die Einheimischen, die für Expeditionen gebucht waren, genossen ihre Macht. Etwa wenn sie ihre Kunden mit einem um den Leib gebundenen Seil hochzogen oder hinabließen. Da klagten Bergreisende schon mal, die Älpler entmündigten sie oder behandelten sie «wie einen Sack».
Die alpinen Techniken, die sie anwandten, beherrschten sie oft seit Jahrhunderten. Und die Geräte, die sie zu Hilfe nahmen, hatten sie ebenfalls schon lange. «Kein einziges», schreibt Martin Scharfe, wurde «erst für die bürgerlichen Bergreisenden und ihre neuartigen Ziele erfunden oder entwickelt». Seile gab es, um Schafe, Ziegen und Rinder sicher ins Tal zu bringen. Steigeisen wurden verwendet, um an steilen Hängen zu mähen oder auf Eisfeldern der Jagd nachzugehen. Und mit Bergstöcken wurde «abgefahren», also sehr schnell den Berg hinabgesprungen. Kurz: Mit ihrem Wissen waren die «Älpler» den gebildeten und aufgeklärten Bürgern oft weit überlegen. Die ersten städtischen Bergtouristen waren oft fasziniert von dem, was Gemsjäger und Hirten konnten.
Obwohl die Herrschaften auf die Mitarbeit der Einheimischen angewiesen waren, verachteten sie die Älpler als rückständig. Dazu gesellten sich Dünkel, man mokierte sich über die Gerüche der Älpler, über ihren Kretinismus, über Inzest in den Dörfern und Ähnliches. Aber ohne die Älpler ging es nicht.
Und das so gedemütigte Bergvolk war sich seiner Fähigkeiten bewusst und trat entsprechend selbstbewusst auf. Außerdem wussten sie, dass die bürgerlichen Alpinisten auch in einem anderen Sinn auf sie angewiesen waren. Denn wenn diese ihre heroischen Berichte verfertigten, die ihnen Renommee in englischen, deutschen oder französischen Salons einbringen sollten, dann mussten die von ihnen bezahlten Bauern, Gemsjäger und Kristallsucher ihre alpinistische Großtat verbürgen. Daher wurden ihre Namen nur sehr selten verschwiegen. Schließlich ging es um das Bergsteigen als Projekt der Naturbeherrschung, es war also Teil von Wissenschaft, die dokumentiert werden musste – nicht nur der Naturwissenschaft, die herausfinden wollte, warum die Luft oben dünner, die Temperaturen niedriger und der Baum- und Pflanzenwuchs weniger war. Es ging auch um die Erforschung der Älpler, dieses «eigenthümlichen Völkchens», wie es 1806 in einer Schrift zur «genaurn Kenntniß der Alpen» heißt. Als 1741 die ersten Engländer in Chamonix ankamen, waren sie noch mit Waffen ausgerüstet, um sich gegen die wilden Einwohner der Wälder zu wehren.
Doch Johann Samuel Ith, Theologe aus Bern, glaubte beispielsweise 1788 in den Gemsjägern so etwas wie praktische Aufklärung zu erkennen: Ihr Klettern auf den Berg sei ein Symbol für das menschliche Streben nach höherer Wahrheit, nach dem «Bürgerrecht» des Himmels. Der Salzburger Naturforscher Karl Maria Ehrenbert Freiherr von Moll lobte 1783 die «Zeitkunde der Aelpler», die er im Zillertal vor allem bei Jägern und Wilderern beobachtet hatte.
Mit ungläubigem Staunen und großer Neugier nahmen die aufgeklärten Städter die jahrhundertealte Fertigkeit der Menschen im Gebirge zur Kenntnis, nicht nur zu überleben, sondern eine eigene Volkskunst entwickelt zu haben und gemsengleich die Berge hochzukommen. Auch die regionale Küche, die von den wenigen gut wachsenden Gemüsesorten geprägt war, zog Interesse auf sich. Interessant etwa auch die Frage, warum – und ganz ohne Instrumente – die Bauern eine so genaue Wetterkunde entwickelt hatten.
Zur Verachtung der zurückgebliebenen Dörfler gehörte deshalb immer auch die Verehrung des «guten Älplers», wie er schon 1729 von Albrecht von Haller in seinem berühmten Gedicht Die Alpen besungen wurde: «In ihren Adern fließt ein unverfälscht Geblüte,/ Darin kein erblich Gift von siechen Vätern schleicht.»
Ohne die mal verspotteten, mal verehrten Älpler ließ sich das Projekt Alpenerschließung nicht durchführen. Und die wussten, was sie wert sind, wie auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1796 an der Kleinen Scheidegg in der Schweiz erfahren musste. «Ein Küher», also ein ungebildeter Bergbauer in den Augen des deutschen Philosophen, «hatte uns von seinem Rahm, den er nach Hause trug, zu trinken angeboten und es unserem Belieben überlassen, wie viel Geld wir ihm geben wollten.» Was an dieser Freundlichkeit des Älplers so hintertrieben war, erklärte Hegel, damals Hauslehrer in Bern, gleich mit: «Diese Gewohnheit, die wir ziemlich allgemein antrafen, hat nicht, wie viele gutherzige Reisende meinen, die da von diesem Hirtenleben sich ein Bild allgemeiner Unschuld und Gutmüthigkeit gemacht haben, in der Gastfreiheit und Uneigennützigkeit ihren Grund, sondern vielmehr hoffen diese Küher dadurch, daß sie die Bezahlung dem Gutdünken der Reisenden überlassen, mehr zu erhalten, als ihre Waare werth ist.» Die Leute in den Alpen traten dem Philosophen zu marktbewusst auf. Der Eroberung der Alpen stellten sich die Alpenbewohner recht clever entgegen.
Die Älpler wussten sich gegen ihre merkwürdigen «Liebhaber» zu wehren. Für 1799 war ein alpinistisches Ereignis besonderer Güte geplant: die Erstbesteigung des Großglockner (3798 m) in den Hohen Tauern, befördert vom Fürstbischof Franz II. Xaver von Salm-Reifferscheidt-Krautheim. Zwei Bauern aus Heiligenblut sollten das Unternehmen als Bergführer leiten. Im Vorfeld wurde schon eine Schutzhütte gebaut, die nach dem Fürstbischof benannt wurde: die Salmhütte. Es gibt das Gerücht, dass die Bergführer, «Glokner» genannt, bei ihren Vorbereitungen im Juli 1799 schon den Kleinglockner erstbestiegen – bestätigt wurde das nie. Sicher ist jedoch, dass der zunächst avisierte Termin für die Glocknerbesteigung ausfallen musste, da er mit der Ernte kollidierte. So wurde der Großglockner erst ein Jahr später bestiegen. Solche Konflikte zwischen den als Träger und Führer vorgesehenen Einheimischen und den Hochtouristen waren keine Seltenheit.
Nicht nur die Ernte, auch religiöse Feste und die Einschätzung von Gefahrensituationen verlangten aus Sicht der Bauern Rücksichtnahmen. Und die sogenannten Älpler gingen dabei meist sehr professionell vor: Religiöse Zeremonien beispielsweise wurden aus ökonomischem Kalkül in das Unternehmen Bergbesteigung eingebaut und so zum Bestandteil der Lohnverhandlungen. Oder die Führer übertrieben mögliche Gefahren, um ihre Honorare in die Höhe zu treiben. Auch von Streiks und anderen Arbeitsverweigerungen wird berichtet.
Die Kompetenz der Einheimischen durfte nicht einfach ignoriert werden. Wer sich darüber hinwegsetzte, bekam es zu spüren: 1820 etwa endete die Montblancexpedition des russischen Physikers Joseph Hamel in einer Katastrophe. Kurz vor dem Gipfel kamen drei Führer durch eine Lawine um, weil Hamel trotz schlechtem Wetter befohlen hatte, die Besteigung fortzusetzen.
Zwischen der meist befehlsgewohnten Herrschaft und den Einheimischen, die es nicht gewohnt waren zu gehorchen, musste stets und ständig alles ausgehandelt werden. 1816 beispielsweise trauten sich die Führer am Montblanc, dem Expeditionsleiter Graf Lusi das Trinken von Wein zu verbieten, da es ihn «sonst am Gehen verhindern» würde. Schon die Frage, wer welchen Alkohol trinkt, offenbarte sich als «Sozialkritik», wie Martin Scharfe schreibt, «nämlich als Kritik an den Trinkgewohnheiten der anderen Klassen, in unserem Fall der Älpler». Hochtouristen tranken eher Wein, Bergführer eher Schnaps.
Im Hochgebirge war die soziale Distanz zwischen den Angehörigen kaum aufrechtzuerhalten. Wenn der moderne Alpinismus erst mit der Französischen Revolution begann, so drückte sich deren «Egalité»-Forderung auch in der Berührung der Körper aus. Um sich am Berg von den hinterwäldlerischen Bergbewohnern abzusetzen, bedurfte es anderer Kriterien als die der bergsportlichen Leistung: die Rede von der Zweckfreiheit, die aus einfachem Kraxeln so etwas Erhabenes wie Bergsteigen machte, gehört dazu.
Die adligen, großbürgerlichen und kirchlichen Herrschaften schrieben die Alpingeschichte. Auf den Bergen war aber auch stets das gemeine Volk: 1802 ging der Hoysen Sepp aus Heiligenblut als «Solosteiger» auf den Großglockner, zwei Jahre zuvor war er schon als Führer oben gewesen. Andere Solobergsteiger des frühen Alpinismus, die ohne Adelstitel und Bischofsrang unterwegs waren, sind Valentin Stanig oder Pater Placidus a Spesda. Stanig, eigentlich Stanic, war Theologiestudent, später Priester und Pädagoge, bestieg um die Jahrhundertwende allein die Watzmannspitze.
Auch Frauen stiegen mit: 1809 war Marie Paradis, eine Bauerntochter aus Bourgeat bei Chamonix, auf dem Montblanc. Die dreißigjährige Bauernmagd war von Männern aus dem Dorf überredet worden, als erste Frau den höchsten Gipfel der Alpen zu besteigen. «Auf dem Grand-Plateau konnte ich nicht mehr weitergehen, ich war sehr krank und legte mich in den Schnee», berichtete sie später. Andere Quellen erzählen, sie habe sich in den Schnee geworfen, geweint und hysterisch geschrien, sie wolle nie wieder aufstehen. Die Männer aus Chamonix, mit denen sie unterwegs war, unter anderem Montblancerstbesteiger Jacques Balmat, trugen und zerrten sie auf den Gipfel. Die erste weibliche Erstbesteigung des Montblanc ging nicht als Triumphzug in die Alpingeschichte ein. Paradis berichtete: «Ich konnte nicht sehen, nicht atmen, nicht sprechen, sie sagten, dass es ein Jammer war, mich anzusehen.» Aber: Sie war oben.
Und es lohnte sich für sie. Nach ihrer Besteigung betrieb sie erfolgreich eine Teestube in dem Dorf Les Pèlerins, wo sie Touristen von ihrem Erlebnis berichtete.
Entscheidend für den aufkommenden Alpinismus ist hier das Entstehen eines gesellschaftlichen Umfelds, das aus der Tätigkeit ein soziales Phänomen machte. Deshalb haben die früheren Alpinisten, die über ihre Erlebnisse schrieben, den Alpinismus nicht begründet: Weder der Dichter Francesco Petrarca, der 1336 auf dem Mont Ventoux (1912 m), dem Windberg, stand, noch der Schweizer Konrad Gesner, der 1555 den Gnepfstein (1920 m), der zum Pilatusmassiv bei Luzern zählt, erklomm. Auch gehobene Damen wie Regina von Brandis und ihre Tochter Katharina Botsch, die 1552 die Laugenspitze bei Meran (2433 m) zusammen mit einem Adligen aus der Gegend bestiegen, sind bestenfalls Vorläufer einer später einsetzenden Bewegung. Petrarca, Gesner, Brandis und Botsch einte, dass sie das Begehen von Bergen als Selbstzweck ansahen. «Ich habe mir vorgenommen», schrieb der Arzt und Naturforscher Gesner 1541 an einen Freund, «so lange mir Gott das Leben gibt, jährlich mehrere oder wenigstens einen Berg zu besteigen, wenn die Pflanzen in Blüte sind, teils um den Körper auf eine ehrenwerte Weise zu üben und den Geist zu ergötzen.»
1787, als de Saussure seinen Traum von der Besteigung des Montblanc wahr gemacht hatte, kam in den Ostalpen am 22. Dezember ein Saumtiertreiber und sein Knecht aus dem Paznaun samt ihren acht Pferden in einer Lawine um. Säumer waren frühe Transportunternehmer, die Lebensmittel und andere Waren über Pässe und Joche brachten und dabei ihr Leben riskierten. Was dem in der Kirchenchronik namenlos gebliebenen Saumtreiber und seinem Knecht passierte, war normal bei denen, die ihren Lebensunterhalt in den Bergen verdienten. Erwähnung fand nur, wer es schaffte, nicht umzukommen. Auf dem Schrofenpass etwa, der auf 1688 Metern von Österreich ins deutsche Oberstdorf führt, wurde im Jahr 1795 der Weg verbreitert, und zwar wurde das «von den Warthern in Fron geleistet», wie der Heimatforscher Oliver Benvenuti schreibt. Von Mai bis September war ein wesentliches Stück des Pfades fertig, und die Warther Pfarrchronik notierte zufrieden, dass «die Wegarbeiter ohne jeden Unfall sehr gut und unermüdlich gearbeitet und nichts Unnnützes verzehrt haben». Bis heute führt über den Schrofenpass nur der damals angelegte Saumpfad.
Die Wege, die die Dorfbewohner bauten, befestigten und instand hielten, waren teilweise in Felsen gehauen, manchmal gingen sie über Holzstege, und auch Seilsicherungen waren schon Jahrhunderte vor dem Alpinismus bekannt. Selbst Haken, Trittstifte oder geschmiedete Ringe fanden Verwendung. Der älteste nachweisbare Eisenring stammt von 1506. Sie sicherten oft waghalsige Steige, um Handelswege abzukürzen. Als Wegmarkierungen wurden Steinmänner oder angeschnittene Äste verwendet.
Ab dem 16./17. Jahrhundert war das Transportwesen in sogenannten Rodgenossenschaften organisiert: Jeder Dorfbewohner einer Gebirgsgemeinde durfte Fuhrmann oder Säumer werden. Das war ein angesehener Beruf, der aber auch mit Pflichten verbunden war. Die Säumer mussten die Straßen instand halten, und im Winter mussten sie «Schneebrechen» und «Spurlegen», um die vom Schnee verdeckten Wege neu auszuzeichnen. Die ganze Rodgenossenschaft kam dann aus verschiedenen Dörfern zusammen, «da wo der Weg durch den Schnee gegraben werden muß, [sie] treiben Ochsen als die stärksten und sichersten Leiter vor sich hin, schaufeln, hacken und graben hinter ihnen den Schnee weg und suchen für die Reisenden, eine erträgliche Straße zu machen», heißt es in einem zeitgenössischen Bericht.
Das Überschreiten von Pässen und Jochen war schon vor der Bronze- und Römerzeit üblich: Schließlich waren die ersten Menschen der Urgeschichte Jäger, Sammler, Abenteurer, auf der Suche nach Wild, Kräutern, Heilpflanzen oder Mineralien. Auch zur Wasserversorgung begaben sich Menschen oft in größere Höhen.
Passübergänge lassen sich ab der frühen Bronzezeit nachweisen. Das waren Wege zum Teil deutlich über 2000 Höhenmetern, etwa Albula, Julier, Septimer, Splügen und Bernhard. Das bewies spätestens der Fund des als «Ötzi» bekannt gewordenen, 5000 Jahre alten Steinzeitmenschen, der 1991 in den Ötztaler Alpen entdeckt wurde. So weit man seine letzten Lebenstage rekonstruieren kann, hielt er sich lange im Bereich der damaligen Baumgrenze auf etwa 2400 Meter Höhe auf, zuletzt war er vermutlich auf dem Tisenjoch, also auf 3200 Meter.
«Ötzi» ging wohl allein, doch andere unserer Vorfahren gingen in Gruppen, als Handels- oder Reisegesellschaften oder Herdentreiber. Die Menschen waren immer auf der Suche nach neuem Weideland, und das fand sich oft erst über der Baumgrenze – schließlich war Rodung im großen Stil noch nicht möglich. So entstanden Bergsiedlungen, sie lagen oft an Weiden und Wäldern. Und das wiederum beförderte den Verkehr zwischen Tal und Berg: Waren wurden ausgetauscht, es entstand ein erstes Wegenetz. Das wurde immer ausgedehnter, ab dem Mittelalter wurden regelmäßig Alpenpässe begangen. Dann kam der Personenverkehr: Pilger, Kreuzfahrer, Adlige und Handelsreisende. Wie beschwerlich die Überquerungen teils nur einzelner Pässe, teils gar der gesamten Alpen waren, schildert im Jahr 1587 der Basler Kaufmann Andreas Ryff. Er klagt, dass «in der enge zwischen den engen, hochen felsen gantz sorglich von holtz gemachte strossen, so ahn die felsen gekleibt» seien, dass er oft Angst hatte. Die Straßen, die er beschreibt, wurden ab dem 13. Jahrhundert für den Handelsverkehr angelegt. Berühmt ist etwa die Reschenstraße, die Via Claudia Augusta. Oder im Bündnerland baute 1387 Jakob von Castelmur, ein Beauftragter des Bischofs von Chur, den ersten befahrbaren Alpenübergang – heute ist der übrigens nur noch ein Fußweg.
Das war auch militärisch interessant: Während des Dreißigjährigen Krieges, im Jahr 1621, wollte Österreich die Bündner Pässe erobern. 700 Soldaten blieben oben, 800 stiegen ab. Auf den anfänglichen Sieg folgte 1622 ein Aufstand der Prättigauer. Die Besatzungstruppen wurden vertrieben, bis heute wird der Ort «Mörderjoch» gerufen.
Und Schmuggler gingen hier über die Grenze, auch wenn sie nicht gerade im Hospiz abstiegen. Man nannte sie oft «Schwärzer», weil sie ihre Gesichter rußten oder mit Fett und Öl verdunkelten. Und nicht selten waren sie mit Fünfzig-Kilogramm-Lasten beladen. «Die Zöllner zu überlisten, erforderte Gerissenheit und Mut, gute Ortskenntnisse und sehr schnelle, kräftige Beine», schreibt der Historiker Oliver Benvenuti.
Zur Geschichte der Alpenüberquerungen gehören auch Schikanen der besonderen Art: Der «Judenzoll» war eine Mitte des 17. Jahrhunderts in vielen Gegenden gültige Verordnung. Sie schrieb vor, dass zum Normalzoll für reisende Juden ein «Judengeld» zu nehmen ist. In Graubünden gab es die besonders bizarre Vorschrift, dass für einen lebendigen Juden über dreißig Kreuzer zu nehmen waren, für einen toten Juden, der über die Grenze transportiert wurde, jedoch das Mehrfache.
Die Menschen gingen, fuhren und stiegen in die Berge, aber man nennt sie nicht Bergsteiger. Damit Bergsteigen zum großen eigenständigen sozialen und kulturellen Phänomen werden konnte, sagt der französische Historiker Paul Veyne, «musste eine gesellschaftliche Gruppe auf den Plan treten, die ihre Spielereien ernst nahm und auch Sinn für methodisches Vorgehen hatte: Dazu bedurfte es des Bürgertums.» Wer zu anderen, zu materiellen Zwecken in den Bergen war – auf der Suche nach Essen oder Schätzen, auf dem Weg von einem Tal in das andere –, musste dem Bürgertum suspekt erscheinen.
«Tragt meine Leiche hinauf!»
1820 bis 1855: Wie sich die Älpler gegen die Hochtouristen wehren und einfach ihre Berge nicht hergeben
Im Jahr 1843, neun Jahre nach der offiziellen Erstbesteigung des Dachsteins, ließ sich Friedrich Simony von einer Frau auf den 2995 Meter hohen Gipfel in den Nordalpen führen. Nanni hieß sie, ihr Nachname ist nicht überliefert. Sie war Sennerin, arbeitete aber oft als Hüttenträgerin, und diesmal half sie, das wissenschaftliche Gepäck des berühmten Bergsteigers aus Wien zum Gipfel zu tragen. Simony gilt als Erschließer des Dachsteingebirges und war ein führender Geograph seiner Zeit. Als Wissenschaftler war er auch am Denken und Fühlen der Älpler interessiert, also fragte er Nanni, wie es ihr oben auf dem Gipfel gefalle, wie es «um ihren Geschmack» stünde. Sie antwortete, dass es früher auf dem Dachstein schöner gewesen sei, «als da, wo jetzt der tote Schnee (die Eisfelder) liegt, noch schöne Alpenböden waren, auf denen viele hundert Kühe ihr reichliches Futter fanden». Nannis Antwort zeigt, dass die Einheimischen die Natur anders wahrnahmen als die Herren aus der Großstadt. Nicht die Schönheit des Panoramas und noch weniger eine von Schnee symbolisierte Unbeflecktheit der Natur interessierte sie. Ihnen ging es um die Grundlagen ihres Lebens. Und dieses Interesse vertraten sie selbstbewusst und offensiv.
Schon 1822 hat sich das Verhältnis der Älpler zu den städtischen Hochtouristen auf eine neue Stufe gehoben: In Chamonix organisierten sich die Männer, die einen Teil ihres Lebensunterhalts damit verdienten, Fremde auf die Berge zu führen. Sie gründeten die Bergführergilde Chamonix, die erste ihrer Art weltweit. Mit ihrer Selbstorganisation wollten sich die Bergler den städtischen Zumutungen entgegenstellen und davon profitieren.
Die Wissenschaftler und Bergtouristen, die seit der Wende zum 19. Jahrhundert in die Alpen reisten, um in den Augen der Dorfbewohner so etwas Sinnloses zu tun, wie auf Gipfel zu steigen, hatten bewirkt, dass die Einheimischen erkannten, welchen Schatz sie da vor ihrer Haustür hatten. Und wenn sie die unbeholfenen Städter sahen, wurde ihnen auch bewusst, dass ihre Kletterfähigkeiten etwas Besonderes darstellten. «Die ‹Bürger› erfanden die Idee, auf die höchsten Berge zu gehen, und setzten die Ziele», schreibt der Kulturhistoriker Martin Scharfe. «Die ‹Bauern› aber, die zumindest für die Systematik der Bergbezwingung keinen Sinn entwickelt hatten, wussten die Mittel, auf die Berge hinaufzukommen.»
Und sie kamen immer häufiger selbständig hinauf, auch die Frauen. Die Trägerin Nanni auf dem Dachstein war kein Einzelfall. 1838 wäre der sechzehnjährigen Marie Karner aus Prad fast die Ortlerbesteigung gelungen. Knapp unter dem Gipfel musste sie mit ihrer männlichen Begleitergruppe umkehren. 1853 war Karoline Pitzner als erste Frau auf der Zugspitze. 1857 bestieg Sidonia Schmiedl aus Heiligenblut den Großglockner – und zwar in Männerhose und in Begleitung des Bergführers Anton Granögger. Und aus den Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts gibt es ein Bild des aus dem Patznauental stammenden Malers Mathias Schmid, das Edelweißpflückerinnen auf einem Berggipfel zeigt. Sie tragen Männerhosen, genagelte Schuhe und rauchen Pfeife.
Das war nämlich auch früher Alpinismus, allerdings, wenn überhaupt, nur bruchstückhaft dokumentiert – eine «Fußnote in der Historie eines Männersports, der sich am Berg über Haus und Herd erheben konnte», wie Reinhold Messner schreibt. Die erste Phase des Frauenbergsteigens wurde erst in den Fünfzigerjahren des 19. Jahrhunderts eingeleitet, und dann waren es nicht mehr Bäuerinnen, Mägde, Sennerinnen und Trägerinnen, die teils aus Spaß, teils aus wirtschaftlichem Zwang hinaufstiegen, sondern städtische Damen. Einen Vorläufer stellte Henriette d’Angeville dar. 1838 bestieg die vierundvierzigjährige Dame aus Ferney bei Genf mit sechs Führern und sechs Trägern als zweite Frau den Montblanc. Unterwegs wurde sie müde, aber, heißt es in ihrem Bericht, «da sagte ich zu den Führern: ‹Wenn ich sterben sollte, ehe ich den Gipfel erreiche, tragt meine Leiche hinauf und lasst sie oben; meine Familie wird euch belohnen, wenn ihr meinen letzten Willen erfüllt.›» Sie kam aber hoch, und um ihren Erfolg so richtig zu zelebrieren, schaute die Grande Dame nicht nur gen Frankreich, sondern sie ließ sich auf dem Gipfel von ihren Führern hochheben – damit sie «höher als der Montblanc sei».
Aus dem ersten Gentlemanbergsteigen wurde allmählich eine Beschäftigung des gesamten Bürgertums, auch auf anderen Kontinenten. Im Jahr 1829 wurde erstmals der Ararat bestiegen, mit 5173 Metern höchster Berg der Türkei, von Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrot, einem Professor, der von Studenten begleitet wurde – und natürlich Trägern.

