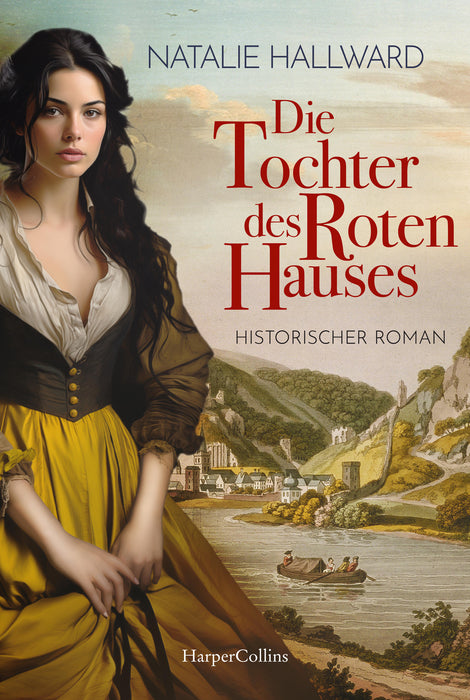
Die Tochter des Roten Hauses
»Vergangenes ist nicht vergessen. Aber leben muss ich heute. Das nimmt mir niemand ab.«
Eifel 1803. Die Franzosen halten unter Napoleon die linke Rheinseite besetzt. In diesen schwierigen Zeiten lässt Anne, eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen, alles hinter sich und macht sich auf die Suche nach dem Mann, der für den Tod eines geliebten Freundes verantwortlich ist. Auf sich alleine gestellt kommt sie im »Roten Haus«, einer Pension in Coblenz, unter. Dort dann lernt sie Sophie von La Roche, Deutschlands erste Reiseschriftstellerin, kennen. Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden Frauen ermöglicht es Anne, der verräterischen Spur des Mörders zu folgen: Ein Gedicht, das er überall im Land an Mauern und Wände schreibt. Zur gleichen Zeit begegnet sie dem Keramikhändler Georg und verliebt sich in ihn. Als der Mann, den sie sucht, plötzlich auftaucht, geraten die Ereignisse außer Kontrolle. Anne muss sich entscheiden, denn wenn sie nicht auf ihre Rache verzichtet, riskiert sie alles zu verlieren, wonach sie bisher gesucht hat.

