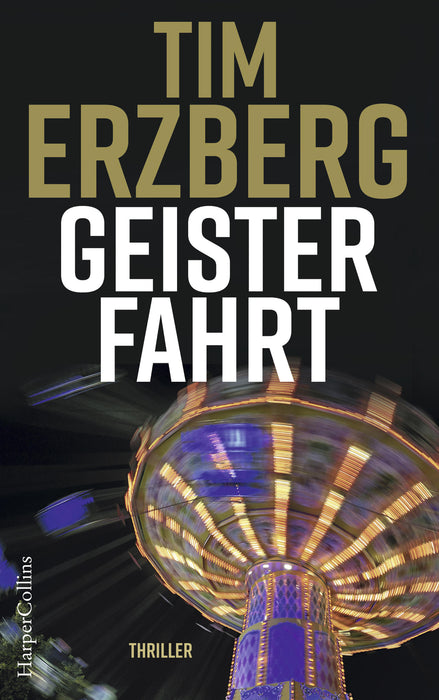
Geisterfahrt
Es hätte ein schöner Tag werden sollen: Anna Krüger und ihre Kollegen von der Helgoländer Polizei sind nach Hamburg gefahren, um das Dienstjubiläum ihres Chefs zu feiern. Auf dem »Hamburger Dom« ist auch dessen neunjährige Tochter Pauline mit dabei. Auf dem Weg in den bunten und hektischen Trubel des Volksfestes macht Anna Krüger eine Entdeckung, deren Tragweite sie sich nicht hätte ausmalen können. Und so wird binnen weniger Stunden der Terror nach Hamburg kommen, ein kleines Mädchen verschwinden und ein Mensch sterben.
»Dramatisch und spannend.«Morgenpost am Sonntag
»Ein grundsolider Kriminalroman mit Hamburg-Flair« Hamburger Abendblatt

