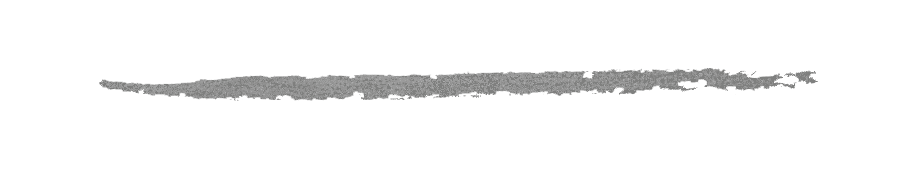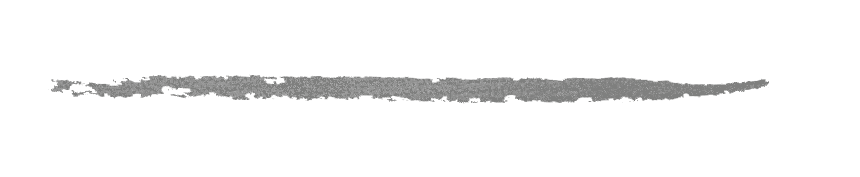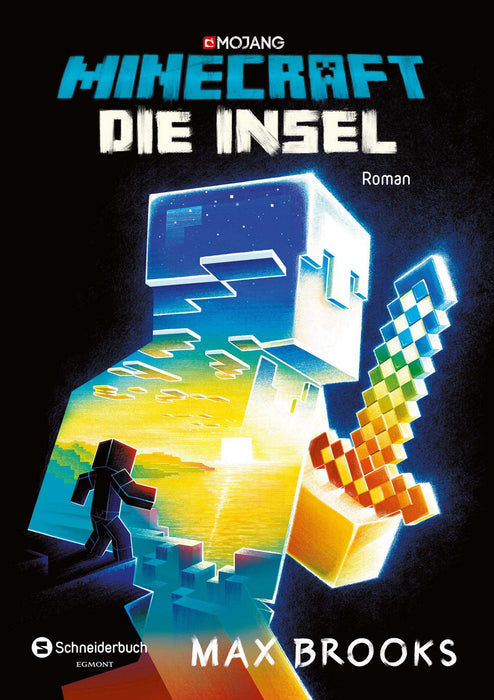
Minecraft - Die Insel
Du wirst nie glauben, was ich erlebt habe. Aber wenn du das liest, steckst du längst mittendrin. Vielleicht stolperst du schon seit einer Weile über diese verrückte Insel. Vielleicht bist du auch gerade erst hier gestrandet. Du bist verwirrt, fühlst dich total verloren und hast eine Scheißangst - das Gefühl kenne ich nur zu gut. Wenn du nicht aufpasst, wird dich die Insel verschlingen und in Einzelteilen wieder ausspucken. Für dich habe ich dieses Buch hier zurückgelassen. Lies es. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst …
Der erste offizielle Minecraft-Roman: Hochspannung von Bestsellerautor Max Brooks