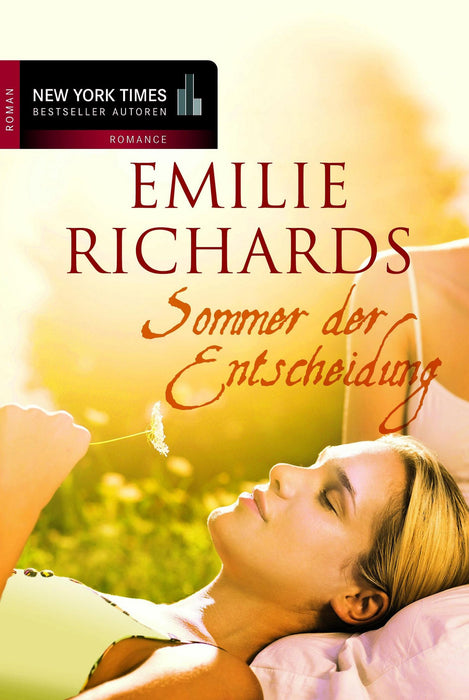
Sommer der Entscheidung
Hat die Liebe noch eine Chance? In der Ehe von Tessa und Andrew MacRae kriselt es, seit ihre kleine Tochter tödlich verunglückt ist. Um in Ruhe über ihre Beziehung nachzudenken und endlich wieder zu sich selbst zu finden, will Tessa den Sommer auf dem Land verbringen. Gemeinsam mit ihrer Mutter fährt sie zu ihrer Großmutter, die ganz allein auf einer abgelegenen Farm lebt. Dabei kommen die drei Frauen, sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich nah. Indem Tessa ihre Familiengeschichte aufarbeitet, hofft sie, die Schatten der Vergangenheit endgültig zu besiegen. Doch gerade als sie wieder Vertrauen in die Liebe fasst, droht eine andere Frau Tessas und Andrews Beziehung endgültig zu zerstören ...

