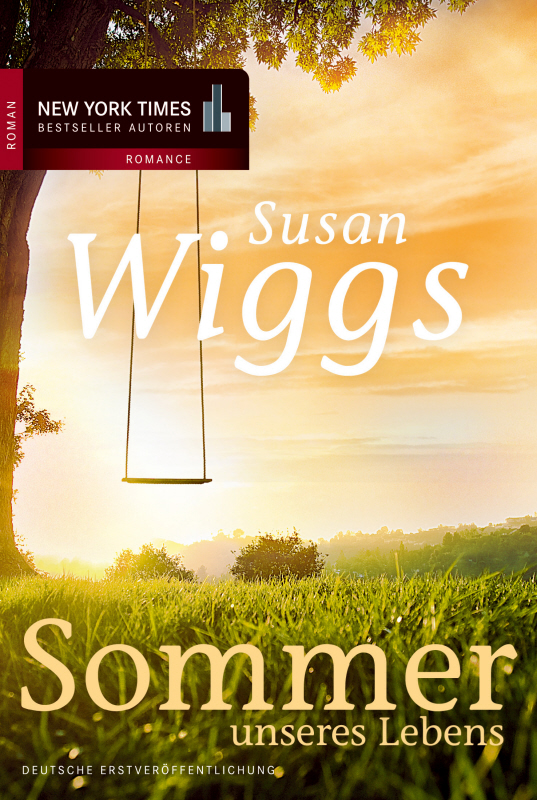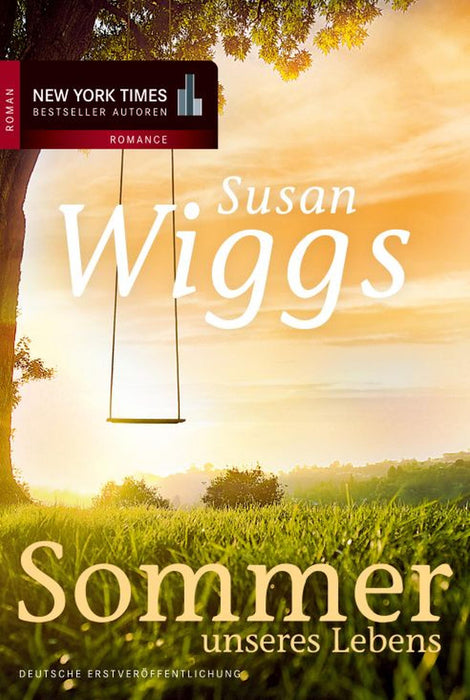
Sommer unseres Lebens
Claire ist ganz hingerissen von ihrem neuen Patienten. Der alte George Bellamy ist ein Charmeur und Gentleman, wie er im Buche steht. Darum zögert sie auch nicht, als er sie bittet, ihn den Sommer über an den Willow Lake zu begleiten. Vielleicht wird sie hier in der Abgeschiedenheit der Berge endlich vergessen können, was ihr so schwer auf der Seele liegt.
Georges Enkel Ross ist die mysteriöse Claire nicht ganz geheuer - obwohl sein Herz jedes Mal in Flammen steht, wenn er in ihrer Nähe ist. Er beschließt, sie zu beschatten - nicht ahnend, dass er damit einen Mörder auf ihre Spur bringt, der sie bis in die idyllische Welt am Rande der Berge verfolgen wird.