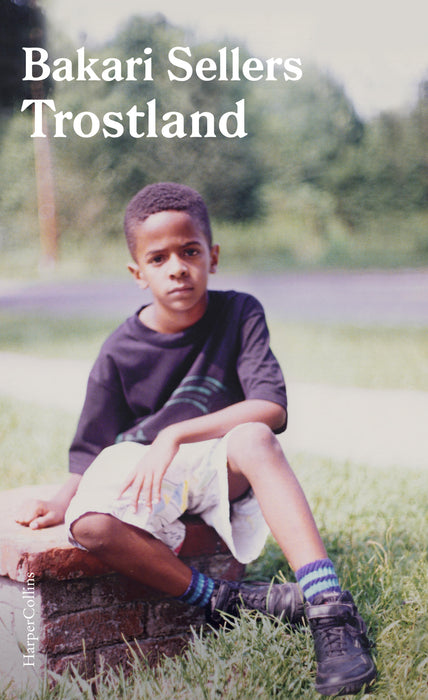
Trostland – Die Geschichte meiner vergessenen Heimat und meiner Familie
Über Wut, Schmerz und die Kraft des Widerstands – ein Blick in die Seele eines zerrissenen Landes
Sie heißen Denmark, Sweden, Finland oder Norway – kleine Städtchen im Lowcountry von South Carolina, die zum Sinnbild des »vergessenen Südens« wurden. Es gibt keine ärmere Gegend in den USA. Großunternehmen verlagern ihren Betrieb ans andere Ende der Welt, Krankenhäuser schließen. Landflucht und Unterdrückung prägen den Alltag der meist afroamerikanischen Familien. Wer den Schuss nicht hörte, blieb hier – alle anderen suchten ihr Glück anderswo.
Es ist die Heimat von Bakari Sellers. Seinen Nachnamen kennt dort jedes Kind. Als Sohn von Cleveland Sellers, Ikone der Aktivisten und Mitstreiter von Martin Luther King, erlebt er die Proteste und Krisen der Bürgerrechtsbewegung von klein auf. In »Trostland« erzählt er vom Aufwachsen in den Südstaaten, von Hoffnung und Scheitern einer Region, in der die historischen Triebkräfte von Aktivismus sichtbar und Rollenbilder neu verhandelt werden. Wie lebt es sich in einer Familie, die das Trauma einer ganzen Bevölkerungsschicht verkörpert? Und wie kann das schier Unmögliche gelingen, nämlich black, country und proud zugleich zu sein?
Eine bildhafte Milieustudie des abgehängten Südens und eine poetische Verneigung vor der Widerstandskraft all jener, die noch immer versuchen, sich eine Heimat zu schaffen, die in Erinnerung bleibt.
»Bakari Sellers ›Trostland‹ ist genau das Buch, das wir jetzt brauchen. […] Seine fesselnde Geschichte beleuchtet nicht nur die Widerstandskraft einzelner Menschen an Orten wie seiner Heimatstadt Denmark, South Carolina, sondern offenbart auch die Gefahren politischer Maßnahmen, die im ganzen Staat umgesetzt werden und verheerende Auswirkungen auf das Leben der Leute haben.«
Hillary Rodham Clinton
»Aus diesen fesselnden Erinnerungen erhebt sich eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit.«
Kirkus Reviews
»Familientraumata – selbst ererbte Traumata – können Kindern enorm viel abverlangen. Doch Bakari Sellers macht in ›Trostland‹ deutlich, dass ein Familientrauma auch eine Kraftquelle sein kann.«
BookPage
»Mir gefiel es, provinziell zu sein, genau wie mein Vater. Denmark liebte ich auf der Stelle. Angeblich lässt sich nach der berühmten Nadel im Heuhaufen ja lange suchen, aber ich fand sie sofort. Worauf wir hier verzichten mussten, war sowieso nie wichtig gewesen. Also pickte ich mir aus dieser alten Stadt alles heraus, was sie mir bot. Ich sprach ihre Mundart, schlenderte auf ihren kaputten Gassen, besuchte ihre Tümpel und Baumwollfelder, die uns als Spielplätze dienten.«
Bakari Sellers, Trostland
»Durch Denmarks trostlose Innenstadt zu fahren ist ein bisschen wie in die Augen eines geliebten Menschen zu blicken und das Funkeln darin nicht mehr zu erkennen. Das Licht ist gedimmt. Was einmal ein Glimmen war, bleibt aus. Denmark ist ein Mikrokosmos des vergessenen Schwarzen Südens, der durch Isolierung, Sparmaßnahmen und schlechte Wohn- und Ausbildungssituation bis ins Mark erschüttert wurde.«
Bakari Sellers, Trostland

