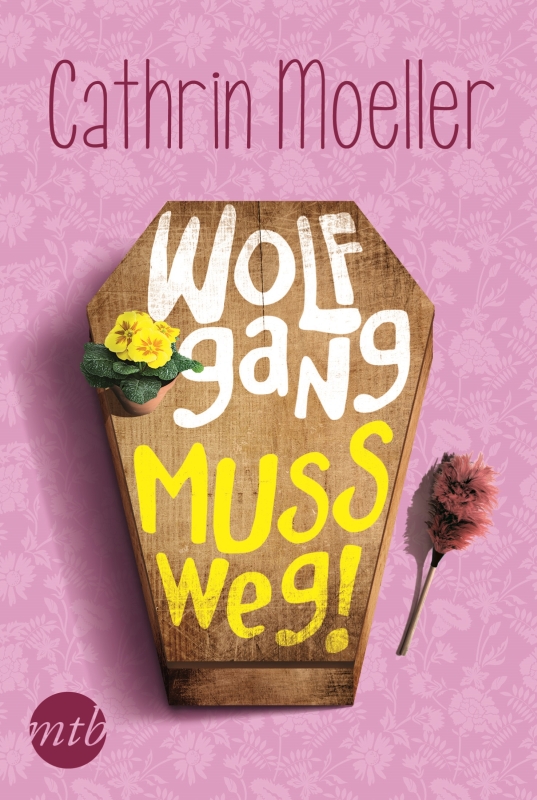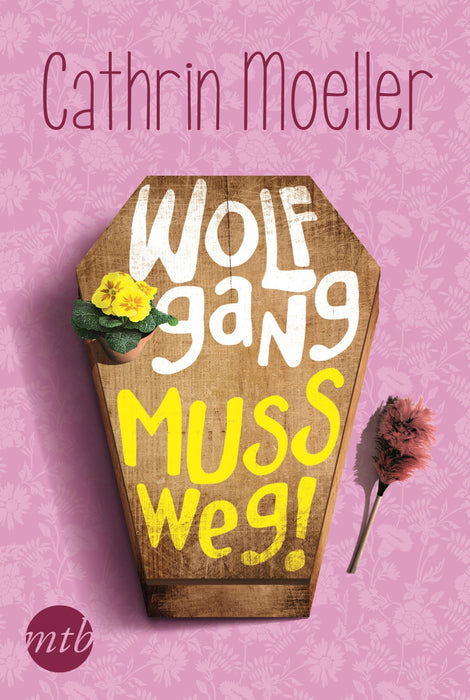
Wolfgang muss weg!
Was macht eine gute Hausfrau, die aus Versehen ihren Mann erschießt? Ganz klar: Sie verwischt alle Spuren! Eine bitterböse Komödie - im wahrsten Sinne des Wortes zum TOTlachen!
Da liegt er nun, ganz friedlich - in der Tiefkühltruhe zwischen Erbsen und Möhrchen: Wolfgang, Annemies Gatte. Einst erfolgreicher Polizist, bekennender Macho, einfallsloser Liebhaber. Jetzt mausetot. Dass es nur ein Unfall war, dafür hat Annemie keine Zeugen. Zum Glück weiß sie als gute Hausfrau, wie man Blutflecken entfernt. Doch als sich plötzlich die anstrengende Schwiegermutter bei ihr einquartiert und Wolfgangs bester Freund beginnt herumzuschnüffeln, begreift Annemie, dass ihr Mann seinen Frieden nicht dauerhaft in der Tiefkühltruhe finden wird. Mit ihrer Schwiegermutter und ihrer besten Freundin Dörte begibt Annemie sich auf eine irrwitzige Odyssee. Vorbei an neugierigen Zöllnern, verzweifelten Ex-Geliebten und einem viel zu attraktiven Carabinieri - immer mit der Leiche im Gepäck …